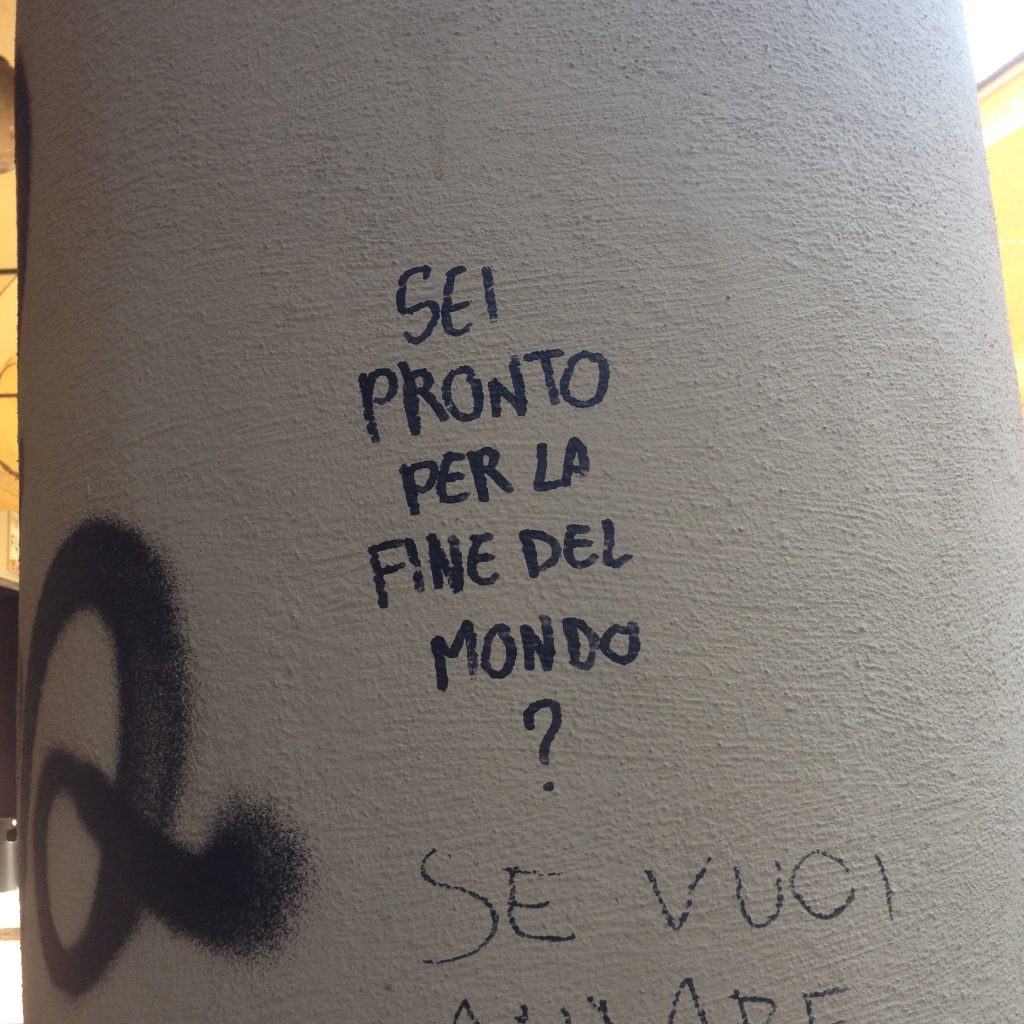Den folgenden Text habe ich 2018 bei einem Wettbewerb eingereicht und bin sogar auf die Shortlist gekommen. Das heißt, meine Reisereportage wurde auf der Website THE TRAVEL EPISODES veröffentlicht – was mich natürlich sehr gefreut hat. Damals hatte ich noch keinen Blog, aber mittlerweile gibt es ihn und ich denke, es ist an der Zeit, den Text heimzuholen.
Ich bin in New York, weil ich noch nie in New York war. Ich glaube, ich möchte mein Bild von dieser Stadt verifizieren. Ich habe Romane wie „Mond über Manhattan“ und „Der große Gatsby“ gelesen und Spielfilmklassiker wie „Frühstück bei Tiffany“ und „Sabrina“ gesehen. Ich möchte wissen, wie viel Wahrheit tatsächlich in den ganzen Hollywoodmärchen steckt – und wie rosarot die Brille war, die ich beim Lesen immer getragen habe. Ob eine Woche New York ausreicht, um diese Fragen zu beantworten? Wir werden sehen.
Neben den Büchern und Filmen, die meine Vorstellung von dieser Stadt geprägt haben, hat sich noch ein weiteres Bild in mein Gedächtnis eingebrannt: ein 1500-Teile-Puzzle, das die New Yorker Skyline bei Nacht zeigte. Es war kein einfaches Motiv und ich brauchte als Kind immer mehrere Tage, um es komplett zusammenzusetzen. Hier zu sein, fühlt sich ganz ähnlich an: Ich versuche, mir ein Bild von dieser Stadt zu machen. Stück für Stück kombiniere ich Gehörtes, Gesehenes und Gelesenes mit meinen eigenen Erfahrungen.
Das hier ist kein Best-of und kein Howto für New York.
Es sind meine Momentaufnahmen einer Stadt, durch die ich mich sieben Tage lang treiben ließ.
Eine der ersten Entdeckungen: New York riecht nach verbranntem Öl. Ich hatte damit gerechnet, dass mir in den Straßenschluchten Abgasgeruch und U-Bahn-Mief entgegenschlagen würden, der „Duft des Molochs“ eben. Doch dafür haben die Stadtplaner das Straßenraster zu großzügig angelegt. Was stattdessen an fast jeder Ecke meine Nase kitzelt, sind die Ausdünstungen von kleinen fahrbaren Imbissständen.
Asiatisch, mexikanisch, halal – hier gibt es für jeden das Passende. Ein erster Vorgeschmack auf den bunten Schmelztiegel der Kulturen, auf den ich mich in den nächsten Tagen einlassen werde. Viel spricht dafür, dass diese Straßenköche alle das gleiche Öl benutzen und es regelmäßig anbrennen lassen. Die Kundschaft scheint das nicht zu stören.
Hier wohnen und arbeiten so viele Menschen, da können nicht alle so empfindlich sein wie ich.
Nächster Punkt: New York ist LAUT! Verkehrslärm und ein fortwährendes Brummen von Klimaanlagen oder Heizungen wabert förmlich durch die Straßen. Augen können auswählen, was sie sehen. Ohren hören alles. Und das ist anstrengend. Daher ist es fast eine Wohltat, von Zeit zu Zeit die Kopfhörer aufzusetzen und den Lärm der Umgebung ausfaden zu können. Und dabei sind mir die viel beschworenen Hupkonzerte auf den Hauptverkehrsadern der Stadt sogar erspart geblieben.
Den eigenen Reise-Soundtrack zu kreieren, hat aber auch noch andere Vorteile. Ob ich in Zukunft immer an SoHo denken werde, wenn „The Sound of Fear“ von Eels in meiner Playlist erklingt? Ich will es stark hoffen. Denn ich habe mich auf Anhieb in dieses Viertel verliebt. In das Klischee des alten New Yorks mit seinen gusseisernen Fassaden samt Feuerleitern in jedem Stockwerk und seinem ramponierten Kopfsteinpflaster. Hier möchte man ein Loft beziehen und aus den großen Fenstern hinunter auf die Straße schauen.
Dort präsentiert ein asiatisches Modell gerade in High Heels den neusten Herbstlook, und bei der angesagten Szeneboutique an der Ecke wartet eine lange Schlange von Menschen geduldig darauf, ein Schnäppchen beim Saisonausverkauf zu ergattern.
Könnte ich mir wirklich vorstellen, hier zu leben? Zuerst winke ich ab. Doch vermutlich hatte Esteban, mein Airbnb-Host, recht, als er mir beim Frühstück gesagt hat: „Eine Woche reicht nicht, um sich an New York zu gewöhnen. Bleib mal drei Monate, dann reden wir weiter.“ Er hat früher in einem riesigen Apartmenthaus in Manhatten gewohnt.
„Die Wohnungen sind winzig, aber wenn man jung ist, gibt es nichts Besseres. So ein Haus ist wie ein kleines Dorf. Jeder kennt jeden. Und direkt vor der Haustür tobt das Leben.“
Das stimmt. New York schläft nie. Und New York vibriert. Ich spreche hier nicht vom „Rhythmus der Stadt“, der mich im übertragenen Sinne gepackt hätte. Nein, ich meine ganz konkret, dass der Boden unter den Füßen zittert. In den U-Bahn-Schächten, in den Hochhäusern, am Broadway und auf dem Times Square. Wie sollte es auch anders sein in einer Stadt, die von Tausenden von Stahlträgern zusammengehalten wird? Ich merke es zum ersten Mal, als ich in Queens auf die Linie 7 warte, die mich nach Manhattan bringen soll. Abseits des Zentrums, wo sich auch mein Airbnb befindet, fahren die Bahnen nicht mehr unter, sondern eine Etage über der Straße. Auf einer gewaltigen Stahlkonstruktion, die vielerorts schon bessere Tage gesehen hat. Kein Wunder, dass es ächzt und quietscht und wackelt, sobald ein Zug im Anmarsch ist – selbst in hundert Meter Entfernung. Mein Verstand sagt: Du weißt ganz genau, das hier jetzt nichts zusammenkrachen wird.
Mein Gefühl sagt: Weiß ich, ist aber trotzdem unangenehm.
Ja, ich spreche mit mir selbst. Das passiert oft, wenn ich allein unterwegs bin. Weil man dann niemanden hat, mit dem man das Erlebte sofort teilen könnte. Auch keinen, der einen in den Arm nimmt, wenn man nervös ist. Aber im Gegenzug braucht man sich auch für nichts rechtfertigen und muss keine Kompromisse bei der Tagesplanung eingehen. Ich muss auf Reisen keine Bucket Lists abarbeiten und alle Sehenswürdigkeiten gesehen haben. Ich plane nicht, wann ich in welchem Restaurant essen werde und es kommt vor, dass ich bei einer U-Bahn-Station aussteige, nur weil ich den Straßennamen lustig finde. Das kann dann schon anstrengend sein. Vielleicht lässt es mich auch etwas konfus erscheinen – aber auf diese spontane Art und Weise kann ich die Welt viel intensiver wahrnehmen.
In einer Stadt wie New York ist man sowieso nie ganz allein. Diese Tatsache bestätigt sich erneut, als ich gemeinsam mit Hunderten von anderen Touristen über die Brooklyn Bridge geschoben werde. Eigentlich sind mir das hier etwas zu viele Menschen auf zu engem Raum, aber ich habe nun einmal ein Faible für Brücken und die Brooklyn Bridge ist eine ziemlich alte Lady für amerikanische Verhältnisse. Die muss ich mir einfach anschauen.
Um mich herum tummeln sich Rucksackträger mit und ohne Selfie-Stick, Souvenirverkäufer und Fotografen mit Hochzeitspaaren im Schlepptau. Sie posieren vor der Skyline Lower Manhattans, direkt neben einem Schild des New Yorker Department of Transportation, welches verkündet, dass es bei Strafe verboten sei, Liebesschlösser anzubringen. No kidding! Ich denke zwar, dass ein Liebesbeweis an der Brooklyn Bridge für 100 Dollar noch einigermaßen erschwinglich wäre, doch ich weiß auch, dass love locks für die Baustatik zu einem ernsthaften Problem werden können. Brücken sollten wirklich nicht unter der Last verliebter Herzen zusammenbrechen müssen.
Als ich durch den Central Park spaziere und auf verschlungenen Pfaden den zweitgrößten See der gigantischen Parkanlage umrunde, sind schon deutlich weniger Menschen unterwegs. Auch wenn der Lärm der Stadt verebbt ist und die verschiedensten Bäume mir einstweilen die Sicht versperren, so weiß ich doch, dass sich auf der nächsten Anhöhe mit Sicherheit wieder ein Wolkenkratzer auf eine surreale Art und Weise über den Baumwipfeln erheben wird. Ich frage mich, wie viel die Besitzer der Apartmenthäuser am Central Park bei ihren Mietern wohl pro Monat für diese Aussicht verlangen können und überquere den „Lake“ an einer schmalen Stelle über die Oak Bridge.
Auf einmal herrscht reger Betrieb. Vormittagsjogger überholen mich auf einer eigens für sie reservierten Spur, Fahrradrikschas kutschieren den eher lauffaulen Teil des Touristenvolks zum nächsten „Geheimtipp“ und am Seeufer drängen sich Menschen mit Fotoapparaten. Ich bahne mir meinen Weg durch den Trubel, bis eine vertraute Melodie an mein Ohr dringt und ich verwundert innehalte. „Moon River“? Ja, da sitzt tatsächlich ein Musiker und spielt die berühmte Melodie aus „Frühstück bei Tiffany“. Sein Instrument mit den zwei Saiten und dem kleiner Resonanzkörper erscheint mir irgendwie fernöstlich, aber die wehmütigen Töne, die es erzeugt, ähneln denen einer Geige. Eine chinesische Erhu, wie ich später herausfinde. Doch im Moment fühle ich mich einfach nur wie Holly Golightly. Das ist New York. Ein Mix aus verschiedenen Kulturen, aus Fiktion und Realität, aus Früher und Heute. Allerdings selten so harmonisch wie in diesem Moment. Das wird mir wieder schmerzhaft bewusst, als ich wenig später auf der 5th Avenue stehe. Vor Tiffany & Co.
Obwohl ich mir nicht allzu viel aus Glitzerkram mache, betrete ich das traditionsreiche Juweliergeschäft mit den winzigen Schaufenstern durch eine schmale Drehtür. Die livrierten Türsteher sehen mir sicher auf den ersten Blick an, dass ich hier nichts kaufen werde. Doch ich bilde mir ein, dass sie mich ähnlich zuvorkommend behandeln wie schon Paul und Holly – damals im Film. Zumindest möchte ich glauben, dass hier noch Wert auf Stil gelegt wird, denn nebenan im Trump Tower tut man das ganz gewiss nicht. Und wenn doch, dann hat es für mich einen negativen Beigeschmack. Der Trump Tower ist genauso alt wie ich. Aber das ist sicher das Einzige, was wir gemeinsam haben. Ein Schild über dem Eingang versichert mir, dass das Gebäude mit dem protzigen fünfstöckigen Atrium „Open to the public“ sei. Ich fühle mich nicht angesprochen. Und tauche ab in die Subway.
Bin gespannt, wo sie mich wieder an die Oberfläche spülen wird.
Am frühen Nachmittag wirkt die Haltestelle an der 5th Avenue wie ausgestorben. Ein ungewohnter Anblick, denn bislang habe ich die Subway in den verschiedensten Teilen der Stadt nur voller Menschen erlebt. Die New Yorker U-Bahn ist das egalitärste Verkehrsmittel, das ich jemals benutzt habe. Jeder fährt hier U-Bahn. Die Frauen mit den teuren Shoppingtüten in der einen und den verwöhnten Töchtern an der anderen Hand, die Studentin, die ihre Nase in die Bücher steckt und offenbar für die nächste Klausur lernt, der Geschäftsmann mit der Aktentasche, der alte Mann, der zwei völlig durchweichte kalte Pizzaschachteln wie einen kleinen Abendessenschatz auf seinen Knien balanciert und der junge Mann mit der Alibi-Kippa, bei der man den Eindruck gewinnt, dass es die kleinste ist, der er gefunden hat – und dass er sie an diesem Freitagabend nur trägt, um seiner Mutter eine Freude zu machen. Es wird wenig gesprochen, weil fast jeder auf sein Smartphone starrt, aber wenn Worte gewechselt werden, dann hört man alle Sprachen dieser Welt.
Zuerst dachte ich, dass die Subway nach dem Prinzip des distanzierten Nebeneinanders funktioniert. Man benutzt das gleiche Transportmittel, aber lässt sich weitestgehend in Ruhe. Doch ich lerne schnell, dass die Subway vielmehr ein sich selbst regulierendes System ist. Als mir einer ihrer Mitarbeiter am ersten Tag den besten Weg zu meinem Airbnb auf seinem Handy heraussucht, halte ich es noch für den üblichen Touristenbonus. Als ich vier Tage später in den Tiefen meiner Jackentasche nach dem Stadtplan krame, werde ich von einem Mitfahrer freundlich darauf hingewiesen, dass ich soeben meine Fahrkarte verloren hätte. Menschen rutschen auf den Sitzbänken zusammen, wenn mehr Leute in die Bahn drängen. Teenager bieten älteren Damen ihren Sitzplatz an. Der Mann zu meiner Rechten reist mit einem fahrbaren Putzwagen und bemerkt nicht, dass sich einer seiner ölverschmierten Lappen selbstständig gemacht hat und auf den Boden gepurzelt ist. Sofort zeigt eine Frau, die uns gegenübersitzt, auf das Corpus Delicti und bittet ihn höflich, den Lappen doch wieder mitzunehmen. Ich weiß nicht, wie, aber dieses System funktioniert.
Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Und an einem Abend bin ich dafür besonders dankbar.
Es ist kurz nach elf und ich sitze in der Bahn. Der Wagen ist halb leer. Ich habe noch die mitreißenden Songs des Musicals „The Book of Mormon“ im Ohr, das ich mir gerade am Broadway angeschaut habe. Als wir losfahren, höre ich, dass jemand am anderen Ende des Wagens zu rappen beginnt. Nachdem gestern ein mexikanisches Duo mit Harmonika und Klampfe in der Bahn ein spontanes Konzert gegeben hat, bin ich einer Hip-Hop- Darbietung heute nicht unbedingt abgeneigt. Doch dieser Rap ist unglaublich aggressiv, frauenfeindlich und obszön. Zuhören ist unangenehm. Ich weiß, dass die Bahn noch gute fünf Minuten bis zum nächsten Stopp braucht. Ich kann hier jetzt nicht raus. Ich tausche Blicke mit den anderen Mädels im Wagen aus. Der Kerl ist uns nicht geheuer, doch wir geben uns Mühe, einfach darüber hinwegzugrinsen. Auch noch, als er sich langsam auf uns zubewegt. Da steht ein alter Mann auf, ein Schwarzer mit grau meliertem Bart, der einen Eimer voll Putzutensilien dabei hat, und versucht, den ziemlich abgerissen aussehenden Rapper zu beruhigen. Er redet leise auf ihn ein und will ihn offenbar dazu bewegen, sich hinzusetzen – was ihm dann schließlich auch gelingt. Nach und nach verändert sich die Tonalität des Sprechgesangs: Es klingt immer weniger aggressiv, dafür umso hilfloser. Ich weiß nicht, welche Kombination von Drogen und Depressionen so etwas bewirken kann, aber ich habe selten einen verzweifelteren Menschen gesehen als diesen Rapper, der auf wie ein Häufchen Elend auf dem Boden saß und im Takt vor und zurück wippte.
Es sind diese Kontraste, die New York so faszinierend machen.
Da sind die Hochhäuser, die stolz in den Himmel ragen, unpersönlich und glattpoliert – und gleich darunter das weitverzweigte U-Bahn-Labyrinth, wo es umso mehr menschelt. Beide Seiten sind durch Stahl und Beton untrennbar miteinander verbunden. Oben gibt es vielleicht mehr Glas und unten mehr Dreck, oben mehr Ruhe und unten mehr Lärm. Aber im Grunde genommen können sie nicht ohne einander.
Ich kann mir nicht ganz erklären, warum ich große Gebäude mag und warum mich eine Stadt fasziniert, in der sich fast alle Straßen auf vollkommen unnatürliche Weise im 90- Grad-Winkel kreuzen. (Abgesehen vom Broadway, der ganz klar aus der Reihe tanzt.) In deren Straßenschluchten manche Häuser kaum Sonne abbekommen und wo so viele Menschen auf so engem Raum zusammenleben und arbeiten, dass man sich Sorgen um seine Privatsphäre machen muss. „Fahr doch in die Berge“, möchte man mir sagen. „Da ist die Aussicht viel schöner. Da hast du unberührte Natur. Da kannst mal richtig durchatmen.“ Das stimmt. Aber trotzdem bin ich hier und ich bin begeistert. Ich habe es genossen, auf dem Dach des Rockefeller Centers zu stehen und den Central Park im Norden und Lower Manhattan samt Empire State Building im Süden zu betrachten. Ich habe mich in der Grand Central Station vom Pendlerstrom mitreißen lassen und vom Aussichtsdeck der Staten Island Ferry die New Yorker Skyline und die Freiheitsstatue bewundert. Ich habe die wohl teuersten Werbeanzeigen der Welt am Times Square fotografiert und den East River mit der Seilbahn überquert – und ich habe mehrmals eine Genickstarre riskiert, indem ich die Wolkenkratzer vom Bürgersteig aus bestaunt habe.
Es ist mir gelungen, einige Teile meines New-York-Puzzles zusammenzufügen. Aber es ist noch lange nicht komplett. Die Stadt hat mich mit ihren Eindrücken überschüttet. Einige Erfahrungen waren intensiv, bei anderen habe ich nur an der Oberfläche gekratzt. Ich könnte die Lücken im Nachhinein kaschieren und diese Reiseerinnerungen etwas harmonischer und chronologischer formulieren. Aber das möchte ich gar nicht. Ich will einen Grund haben, wiederzukommen. Und das werde ich, allerdings nicht allein.
Ich bin schon jetzt gespannt, in welchen Farben das Empire State Building beim nächsten Mal erleuchtet sein wird. Vorerst werde ich es in schlichtem Weiß in Erinnerung behalten.
„Signature White“, wie es im offiziellen Beleuchtungsplan heißt. Ja, so etwas gibt es. Und es muss auch diesen Menschen geben, diese eine Person, die auf die Frage „Und, was machen Sie so?“ antworten kann: „Ich bin der Oberbeleuchter vom Empire State Building.“
New York ist definitiv die Stadt mit den coolsten Jobs der Welt.